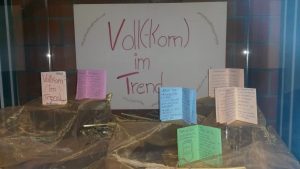BzB3 reiste nach Berlin
Berlin, Berlin – wir fahren nach Berlin!
Kaum das Zeugnis in der Hand, verließ die Klasse BzB3 mit ihrer Klassenlehrerin Frau Herrmann die Stadt Wiesbaden, um in die Bundeshauptstadt Berlin zu reisen. Nach einer kurzweiligen Zugfahrt wartete vor Ort ein volles Programm. Neben einer Stadtführung zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt galt als besonderes Highlight der Besuch eines Vortrags im Plenarsaal des Deutschen Bundestags. Auch der Besuch der Glaskuppel bei sonnigem Wetter mit Blick über ganz Berlin war eine ganz tolle Sache. Abgerundet wurde dieser Tag mit einem Gespräch bei der Landtagsabgeordneten Frau Schulz-Asche und einem leckere Mittagessen im Paul-Löbe-Haus.
Neben diesen Bildungsprogrammpunkten gab es natürlich auch reichlich Zeit für Spaß. Das Programm sah für jeden etwas vor, von Shopping über 3D-Schwarzlicht-Minigolf zu Madame Tussaud. Ein besonderes Highlight der Reise war auch ein gemeinsamer Abschlussabend in der, aus der Serie „Berlin – Tag und Nacht“, bekannten Disco „Matrix“.
Mit jeder Menge Spaß, tollen Fotos und Erinnerungen endete die viertägige Reise wieder, doch weitere Ausflüge sind bereits geplant.



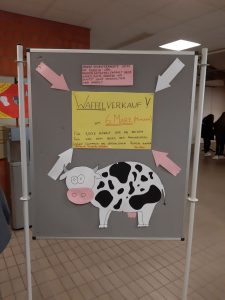

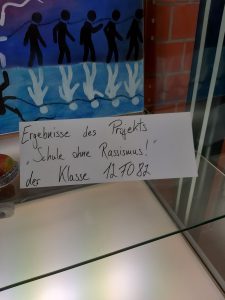


 Am 28.02.2019 wurde an der LSS erneut ein Präventionstag zum Thema „Rauchen“ durchgeführt. Nach dem Motto „Ohne Rauch geht’s auch!“ veranstaltete die AOK im Foyer der Louise-Schroeder-Schule ganztägig einen Informationstag, zu dem alle Schülerinnen und Schüler und auch alle Lehrerinnen und Lehrer eingeladen waren. Fragen rund um das Rauchen konnten beantwortet werden. Individuelle Beratungen fanden statt, aber vor allem konnte jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer durch eine Messung testen, welche Gesundheitsgefährdung bei jedem einzelnen durch das Rauchen vorliegt. Einzelne sind bestimmt mit interessanten Ergebnissen nachhause gegangen – hoffen wir, dass sie der Entwöhnung gedient haben. Als kleines Dankeschön erhielt jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer einen blinkenden Kugelschreiber, der daran erinnern soll, rauchfrei zu bleiben. „Rauchfrei durchs Leben“ scheint die gesündeste Devise zu sein, um bestimmte Krebsarten zu umgehen!
Am 28.02.2019 wurde an der LSS erneut ein Präventionstag zum Thema „Rauchen“ durchgeführt. Nach dem Motto „Ohne Rauch geht’s auch!“ veranstaltete die AOK im Foyer der Louise-Schroeder-Schule ganztägig einen Informationstag, zu dem alle Schülerinnen und Schüler und auch alle Lehrerinnen und Lehrer eingeladen waren. Fragen rund um das Rauchen konnten beantwortet werden. Individuelle Beratungen fanden statt, aber vor allem konnte jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer durch eine Messung testen, welche Gesundheitsgefährdung bei jedem einzelnen durch das Rauchen vorliegt. Einzelne sind bestimmt mit interessanten Ergebnissen nachhause gegangen – hoffen wir, dass sie der Entwöhnung gedient haben. Als kleines Dankeschön erhielt jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer einen blinkenden Kugelschreiber, der daran erinnern soll, rauchfrei zu bleiben. „Rauchfrei durchs Leben“ scheint die gesündeste Devise zu sein, um bestimmte Krebsarten zu umgehen!